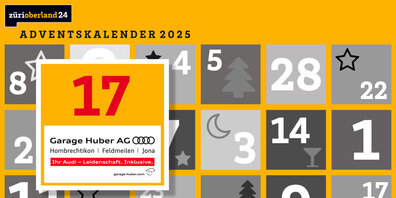Im März 2024 entschied der Zürcher Regierungsrat, das Gesuch der GZO AG über 180 Millionen Franken abzuweisen (wir berichteten). Das sorgt damals wie heute bei einem Teil der Bevölkerung auf Unverständnis. Einige befürchten – neben dem Verlust von Arbeitsplätzen – dass die Gesundheitsversorgung im Zürcher Oberland mit dem Wegfall des Spitals nicht mehr gewährleistet wäre.
Der Zürcher Regierungsrat beurteilt das GZO-Spital hingegen als «nicht unverzichtbar» bzw. als nicht systemrelevant. Analysen der Fallzahlen im Jahr 2024 hatten ergeben, dass zwar kurzfristig mit längeren Wartezeiten zu rechnen sei, die Versorgung der Bevölkerung im Zürcher Oberland aber nicht gefährdet und mit den umliegenden Spitälern gesichert sei. Der Entscheid basierte auch auf dem seit 2012 geltenden Spitalplanungs- und -Finanzierungsgesetz (SPFG).
So war es früher
Bis Ende 2011 erfolgte die Spitalfinanzierung objektbezogen. Das heisst: Die Kantone bezahlten den – in der Regel öffentlichen oder öffentlich subventionierten – Spitälern einen Sockelbeitrag von mindestens 50 Prozent der Betriebskosten. Den Rest, den sogenannten Grundbeitrag, finanzierten die Krankenkassen über die Grundversicherung. Ob einem Spital der kantonale Sockelbeitrag ausgerichtet wurde, war von der Spitalplanung des jeweiligen Kantons abhängig.
Im Kanton Zürich mit seiner A- und B-Liste erhielten die Spitäler auf der A-Liste den Sockel- und den Grundbeitrag. Die (privaten) Spitäler auf der B-Liste erhielten nur den Grundbeitrag. Der Sockelbeitrag wurde bei diesen Spitälern durch die Zusatzversicherung gedeckt.
SPFG-Gesetz seit 2012
Seit 2012 werden die auf der kantonalen Spitalliste geführten Spitäler im Sinne einer sogenannten Subjektfinanzierung abgegolten: Finanziert wird nicht mehr das Spital als Institution, sondern dessen tatsächliche Leistungen an Patienten. Der Kanton beteiligt sich mit mindestens 55 Prozent an den Kosten dieser Leistungen, der Rest entfällt auf die Versicherer. Die Entschädigung der Listenspitäler für stationäre Leistungen nach dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) richtet sich nach den Tarifverträgen oder den Tariffestsetzungen.
Das Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetz (SPFG) sieht mehrere Situationen vor, in denen der Kanton Listenspitäler finanziell unterstützen kann, wenn diese nicht selbst über die nötigen finanziellen Mittel für bestimmte Leistungen oder für die Finanzierung der Infrastruktur, die für die Spitalversorgung notwendig ist, verfügen.
So kann der Regierungsrat den Listenspitälern Darlehen bis zu 100 Prozent der Mittel gewähren, die für die Erstellung oder Beschaffung von für die Spitalversorgung notwendigen Anlagen erforderlich sind. Anstatt Darlehen zu gewähren, kann der Regierungsrat auch durch die Gewährung von Sicherheiten die Aufnahme von Fremdkapital bei privaten Geldgebern erleichtern. Die Gewährung entsprechender Sicherheiten kann von einer Gegenleistung abhängig gemacht werden.
Kein Rechtsanspruch auf Geld
Bei den Darlehen handelt es sich nicht um objektbezogene Staatsbeiträge im herkömmlichen Sinn. Vielmehr sind die Darlehen zu sichern, risikobezogen zu verzinsen und innert angemessener Frist zu amortisieren. Darlehen bzw. Sicherheiten sind zweckgebunden. Gewährt werden können sie nur für die Beschaffung oder Erstellung von für die Spitalversorgung notwendigen Anlagen, nicht jedoch beispielsweise ganz abstrakt bzw. allgemein für die Aufrechterhaltung der Betriebsführung des Spitals. Auf die Gewährung von Darlehen bzw. Sicherheiten besteht kein Rechtsanspruch.
Thema Versorgungsnotstand
Das SPFG regelt auch die Handhabe im Falle eines Versorgungsnotstandes. Der Kanton muss im Falle eines (drohenden) Versorgungsnotstands geeignete Massnahmen ergreifen und damit die notwendige Spitalversorgung sicherstellen.
Der Kanton ergreift Massnahmen, wenn der Weiterbestand eines zur Versorgung der Zürcher Bevölkerung unverzichtbaren Listenspitals mit Betriebsstandort im Kanton Zürich bedroht ist. Mögliche Massnahmen sind Darlehen oder Subventionen für den Betriebserhalt notwendigen Mittel. Auch eine Beteiligung an der Trägerschaft privater Spitäler, betriebsnotwendige Infrastrukturen oder Betriebsgesellschaften sind möglich. Die Massnahmen können mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden, die Gemeinden können bei von ihnen betriebenen Listenspitälern gleichartige Massnahmen ergreifen.
Regierungsrat entscheidet
Welche Massnahmen zur Abwendung eines Versorgungsnotstands geeignet, notwendig und angemessen sind, entscheidet der Regierungsrat. Aus dem SPFG ergibt sich nicht, wann ein Versorgungsnotstand im Sinne des Gesetzes anzunehmen ist bzw. wann ein Listenspital als unverzichtbar gilt. Ein Spital, das mit Leistungsaufträgen auf der Spitalliste des Kantons geführt ist, hat also nicht automatisch Anspruch auf Hilfe.
Der Regierungsrat schreibt in seinem Beschluss vom März 2024 dazu: «Aus dem Umstand, dass ein Spital mit Leistungsaufträgen auf der Spitalliste des Kantons geführt ist, lässt sich nicht ohne Weiteres ableiten, dass ein Wegfall dieses Leistungserbringers im konkreten Fall tatsächlich zu einem Notstand in der Spitalversorgung des Kantons Zürich führen würde.»
Die Einschätzung, ob ein Spital insgesamt als unverzichtbar für die Versorgung der Zürcher Bevölkerung gilt, hänge im Einzelfall von zahlreichen Faktoren ab und könne sich im Laufe der Zeit, z. B. durch Veränderungen in der Versorgungslandschaft, Änderungen bei Nachfrage oder Bedarf oder infolge veränderter weiterer Begleitumstände, wandeln. Auch könne sie im Einzelfall in Bezug auf gleichartige Leistungserbringer unterschiedlich ausfallen. «So kann ein Spital in einer Leistungsgruppe versorgungsrelevant sein, während es in einer anderen Leistungsgruppe einen nur marginalen Anteil der Leistungen für die Zürcher Bevölkerung erbringt», so der Regierungsrat.
Kein Notstand, wenn es andere Spitäler gibt
Zu prüfen sei stets auch, ob andere Spitäler durch einen Kapazitätsausbau in der Lage wären, die erwarteten Leistungsmengen des bedrohten Listenspitals abzudecken, ob für die Patienten also eine angemessene und (gut) erreichbare Alternative bzw. Ausweichmöglichkeit für die fraglichen Leistungen zur Verfügung stehe.
Von wesentlicher Bedeutung ist gemäss Regierungsrat zudem der zeitliche Horizont: Kann der kurzfristige Wegfall eines Leistungserbringers in gewissen Leistungsbereichen für die Versorgung der Bevölkerung kritisch sein, ist es durchaus möglich, dass diese Leistungen mittel- oder langfristig ohne Weiteres von anderen Spitälern erbracht werden können. Während bei bestimmten Leistungen längere Wartezeiten für die Patientinnen und Patienten grundsätzlich in Kauf genommen werden können, ist in anderen Fällen der Zugang zu sofortiger medizinischer Versorgung zwingend.
Ein Listenspital hat nicht automatisch Anspruch
Das SPFG bietet dem Kanton somit die Rechtsgrundlage, um im Einzelfall mit geeigneten Massnahmen die Spitalversorgung der Zürcher Bevölkerung sicherzustellen, wenn ein Versorgungsnotstand droht oder bereits besteht. «Ein in seinem Weiterbestand bedrohtes Listenspital kann aber keinen Rechtsanspruch auf das Ergreifen von Massnahmen durch den Kanton, beispielsweise die Gewährung eines Darlehens oder einer Bürgschaft, ableiten.» Ein Spitallistenplatz gehe insbesondere nicht mit einer «Staatsgarantie» einher, die zu einer Finanzierungspflicht des Kantons bei finanziellen Schwierigkeiten der Listenspitäler führen würde.